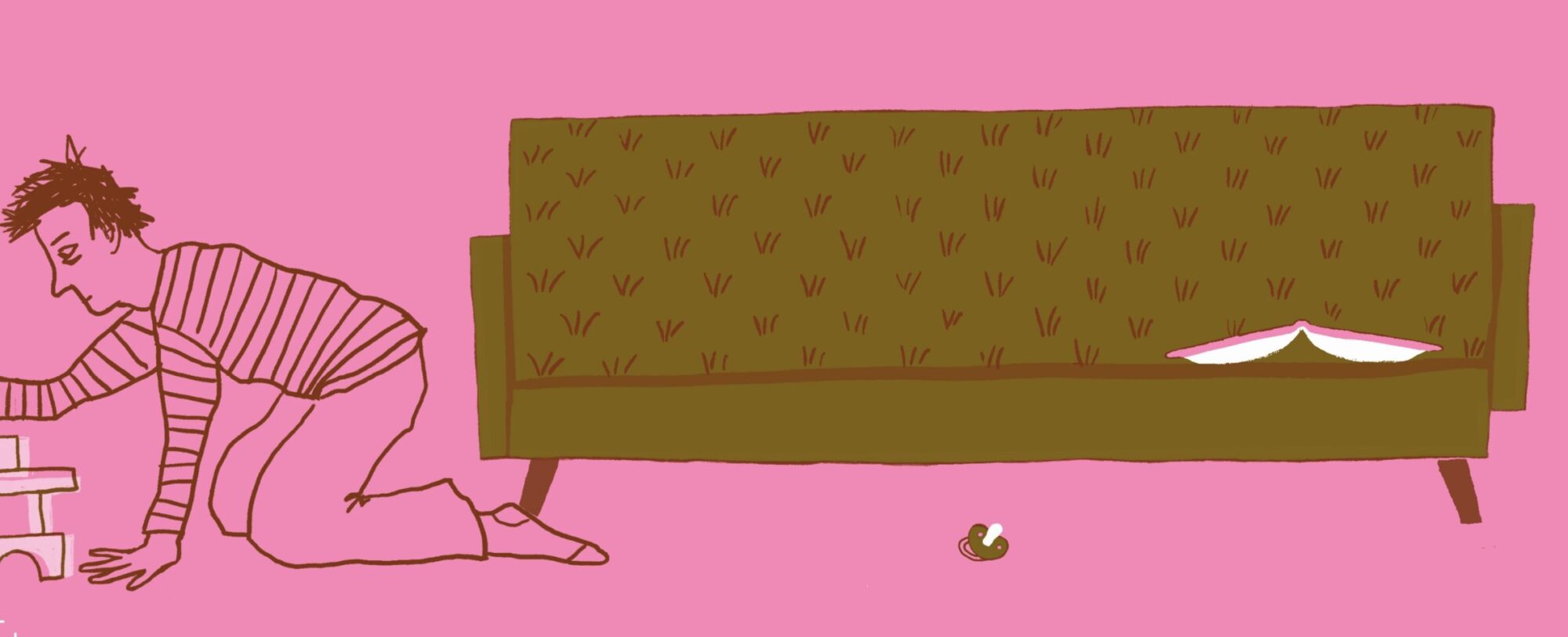Hatte deine Vaterschaft einen inhaltlichen Einfluss auf dein Buch? Welchen?
Clemens Böckmann: Auf jeden Fall. Die Geburt von meinem Sohn fiel genau in jene Zeitspanne, in der ich auch an dem Buch gearbeitet habe. Dadurch sind nochmal ganz andere Themen für mich präsenter geworden, als sie es vorher waren.
Hatte deine Vaterschaft Einfluss auf die alltägliche Schreibarbeit? Welchen?
Clemens Böckmann: Auf der einen Seite hat die Vaterschaft mehr Regelmäßigkeit bedeutet. Das hat geholfen, weil das Arbeiten fokussierter und weniger intuitiv wurde. Gleichzeitig waren es die Jahre der Corona-Pandemie: Ohne den Tagesvater hätte ich vermutlich gar keine Zeit zum Schreiben gehabt. Da verschwand für mich auch erst mal eine Vorstellung von Zukunft. Es geht vor allem viel um Gegenwartsbewältigung.
Stehst du wegen der vermehrter Schreibzeit oder nun kommender Lesungen in der Schuld anderer Familienmitglieder?
Clemens Böckmann: Ich weiß nicht, ob Schuld das richtige Wort ist. Wir müssen das gemeinsam aushandeln und das geht nur auf der Basis von Vertrauen. Ich bin sehr dankbar für alle um mich herum, die gemeinsam für dieses Kind da sind. Gleichzeitig gibt es hier Verständnis dafür, dass Arbeitszeiten auch mal am Wochenende oder abends sind. Umso besser lässt es sich ausgleichen.
Was hältst du davon, das Entstehen eines Buches mit dem Heranwachsen eines Babys zu vergleichen und sein Erscheinen mit der Geburt? Ist dieser Vergleich für dich stimmig?
Clemens Böckmann: Bei einem Buch habe ich doch jederzeit die Möglichkeit zu sagen: Ich will das nicht mehr. Für mein Kind aber bin ich bestenfalls immer da. Ich bin auch ganz froh, dass auf dem Ultraschall kein Buch, sondern ein Herz, ein Kopf und ein paar Arme zu sehen waren. Da gibt es eine körperliche Ebene, die kein Buch jemals wird ersetzen können.
Auf welches Stipendium hast du dich nicht beworben, weil du Kinder hast?
Clemens Böckmann: Auf sehr viele. Anfänglich habe ich es noch gemacht. Ein paar Erfahrungen haben dann aber gereicht. Die Vorstellung, lange von meinem Kind weg zu sein und die Leute in meiner nächsten Umgebung zusätzlich zu belasten, sind die 700€ im Wald nicht wert. Ich brauche auch den Austausch zum Arbeiten, mit meinem Umfeld, meinem Kind.
Welches Stipendium würdest du auch mit Kind nicht ablehnen?
Clemens Böckmann: Eines, bei dem Platz für alle ist.
Welche*n other writer würdest du gern zufällig auf einem Spielplatz treffen und worüber würdest du mit ihm*ihr sprechen?
Clemens Böckmann: Ich hab Sebastian Schmidt lange nicht mehr gesehen. Darüber würde ich mich freuen. Themen gäb es eh genug, so viel wird bisher ja noch nicht über Vaterschaft gesprochen.
Clemens Böckmanns Debütroman Was du kriegen kannst erschien im Oktober 2024 im Hanser Verlag.